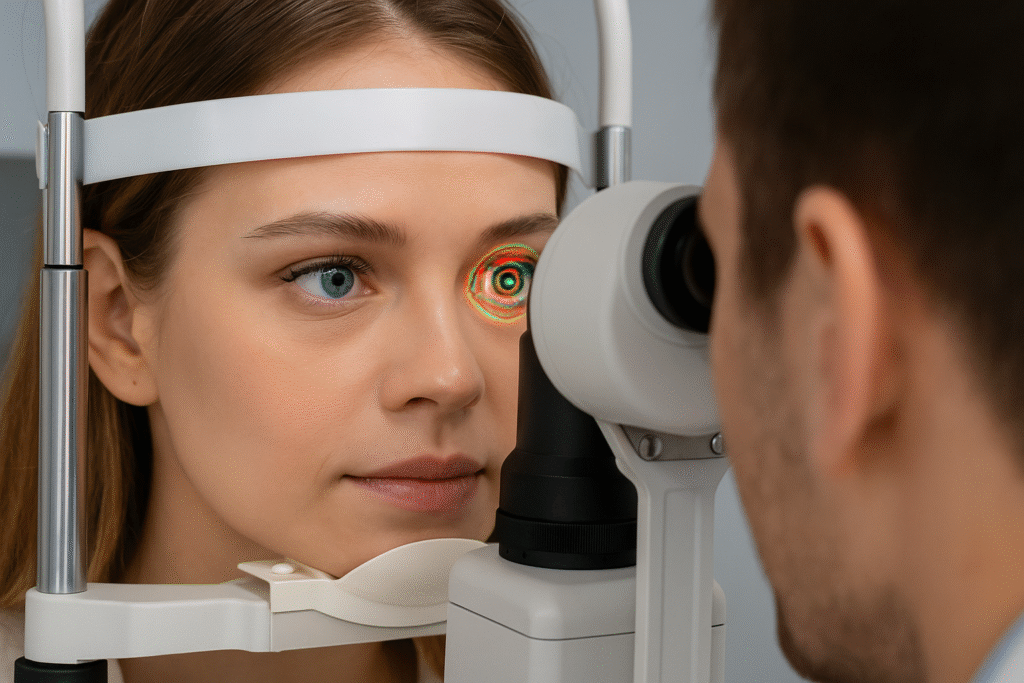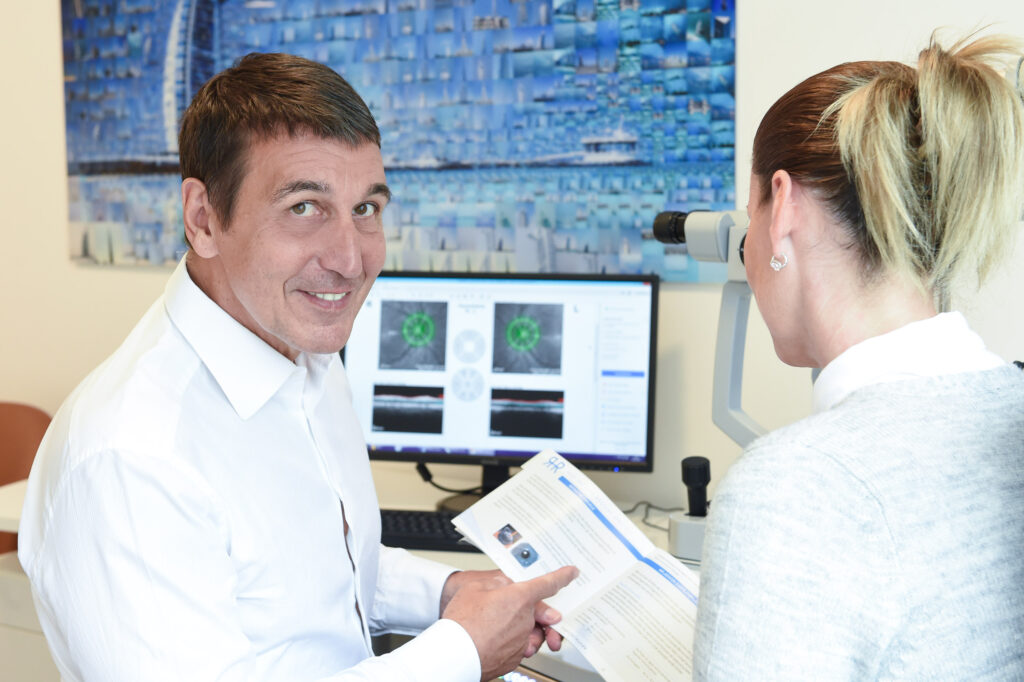München (OTS) – München (ots)
– Drei Nachwuchsforscherinnen und -forscher haben je einen Starting
Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) für ihre Projekte mit der
LMU eingeworben.
– Erfolgreich waren Projekte aus den Bereichen Nanophysik, Protein-
Design und Kulturwissenschaften.
– Die mit je 1,5 Millionen Euro dotierten Grants gehören zu den
angesehensten Forschungsförderungen in Europa.
Der Nanoforscher Quinten Akkerman, die Kulturwissenschaftlerin
Marianna Mazzola und der Biophysiker Lukas Milles bekommen für ihre
neuen Forschungsprojekte an der LMU jeweils einen Starting Grant des
Europäischen Forschungsrats (ERC). Die Förderung beträgt jeweils etwa
1,5 Millionen Euro. Der ERC vergibt Starting Grants anhand der
wissenschaftlichen Exzellenz der Antragstellerinnen und Antragsteller
sowie des beantragten Projekts. Sie zählen zu den angesehensten
Forschungsförderungen in Europa.
Die Projekte im Einzelnen:
Kontrolle über Quantenpunkte
Dr. Quinten Akkerman leitet die Arbeitsgruppe „Quantenpunkt-
Synthese und -Charakterisierung“ am Lehrstuhl für Photonik und
Optoelektronik, Nano-Institut der LMU.
In der Nanophysik sind in den vergangenen Jahren sogenannte
Quantenpunkte (engl. Quantum Dots, kurz QD) in den Fokus der
Forschung geraten. Diese QDs besitzen neue und unerwartete
Eigenschaften, die sich für innovative Bauelemente in der Elektronik,
Optoelektronik und Quanteninformationsverarbeitung nutzen lassen. Ein
Beispiel sind hier die sogenannten Bleihalogenid-Perowskit-
Quantenpunkte (PeQDs). Sie sind ein vielversprechender Kandidat, der
die steigende Nachfrage nach kleineren, effizienteren und komplexeren
Bauteilen erfüllen könnte. Ihre Ionenchemie ist allerdings schwer zu
kontrollieren, was ihre Abstimmbarkeit, Stabilität, Verarbeitbarkeit
und Effizienz einschränkt. Daher ist es aktuell noch schwer, sie in
effiziente optoelektronische und Quantenbauelemente zu integrieren.
Hier setzt das nun mit einem ERC Starting Grant ausgezeichnete
Projekt CONTROL von Quinten Akkerman an. Ziel ist es, die erste
Generation von PeQDs mit vollständig abstimmbaren Ligandenhüllen und
epitaktischen Grenzflächen mit Nicht-Perowskit-Halbleiter zu
entwickeln. CONTROL soll dabei nicht nur grundlegende Erkenntnisse
zur Synthese und den Liganden von PeQDs liefern, sondern auch
wichtige Fortschritte bei der Abstimmung ihrer optischen
Eigenschaften und ihrer Oberflächenchemie erzielen. Basis dafür ist
ein grundlegendes Verständnis der komplexen und schnell ablaufenden
chemischen Prozesse. CONTROL wird dabei neue Instrumente entwickeln,
beispielsweise eine automatisierte Syntheseplattform mit In-situ-
Spektroskopiefunktionen.
Die Erkenntnisse von CONTROL werden dazu dienen, die Synthese von
PeQDs neu zu gestalten, mit dem Ziel, ihre optischen Eigenschaften
und die Oberflächenchemie weiter zu verbessern und die QDs so
vorzubereiten, dass sie sich effizienter in die nächste Generation
innovativer Bauelemente integrieren lassen.
Christliche Bischöfe in der islamischen Periode
Dr. Marianna Mazzola ist Assistenzprofessorin an der Universität
Pisa und assoziiertes Mitglied des Munich Research Centre for Jewish-
Arabic Cultures .
Marianna Mazzola untersucht in ihren Arbeiten, wie die sozialen,
religiösen und politischen Veränderungen der islamischen Periode (von
der Mitte des 7. bis ins 10. Jahrhundert) die christlichen Gemeinden
des Nahen Ostens prägten, wie sie etwa deren bischöfliche Leitung,
Netzwerke und Machtstrukturen veränderten. Zum ersten Mal kann sich
Mazzola bei ihrem neuen Projekt MASLAB (Making the Islamicate Bishop:
Episcopal Governance and Networks under Islam) auf ein mehrsprachiges
und gattungsübergreifendes Korpus stützen. Dies ermöglicht es ihr zu
untersuchen, wie die Bischöfe mit den sich wandelnden Umständen
umgingen und welche Beziehungen und Ressourcen sie als Reaktion auf
die neuen gesellschaftspolitischen und religiösen Dynamiken
mobilisierten. Dazu gehören die rechtliche Kodifizierung des sozialen
Status von Nicht-Muslimen, die Herabstufung des Christentums von
einer kaiserlich geförderten Religion zu einer politischen
Minderheit, die Herausbildung innerchristlicher Konfessionsgrenzen
sowie eine fluide und föderalisierte Vorstellung von Macht und
Territorialität.
Mazzolas Ansatz ermöglicht ein neuartiges Verständnis der
bischöflichen Führung in der islamischen Periode, die das
vorherrschende Paradigma dekonstruiert, das nicht-muslimische Gruppen
als monolithische, staatlich anerkannte Einheiten betrachtet und die
bischöfliche Beziehung zur Macht nur durch das dyadische Modell
„Bischof-Kalif“ versteht. MASLAB verlagert den analytischen Fokus von
binären Paradigmen hin zu einem Modell mit mehreren Akteuren und
betont politische statt ausschließlich religiöse Interpretationen,
wobei die soziopolitische Variabilität islamischer Herrschaft
angemessen berücksichtigt wird.
Protein-Mechanik effizienter bestimmen
Lukas Milles ist Professor für De-novo-Protein-Design, leitet
eine Arbeitsgruppe am Genzentrum der LMU und ist Mitglied im
Exzellenzcluster BioSysteM . Er forscht daran, wie sich mithilfe von
Künstlicher Intelligenz völlig neue Proteine mit spezifischen
Eigenschaften konstruieren lassen.
Mechanische Kräfte, die die Wechselwirkungen und Faltung von
Proteinen steuern, spielen in der Biologie eine zentrale Rolle. Sie
bestimmen das Schicksal von Zellen und sind entscheidende Faktoren
bei Infektionsprozessen von Krankheitserregern und der Immunantwort
darauf. Insbesondere sogenannte Catch Bonds sind bei diesen Prozessen
wichtig. Catch Bonds sind atypische Bindungen, die ihre Lebensdauer
unter mechanischer Kraft verlängern, obwohl man intuitiv erwarten
würde, dass sich die Lebensdauer unter Kraft verkürzt.
„Derzeit verfügen wir weder über Modelle noch über ausreichend
große Datensätze, um eine Catch-Bindung allein anhand der
Proteinstruktur vorherzusagen, geschweige denn neue Catch-Bindungen
künstlich zu konstruieren“, so Milles. Deswegen untersuche man die
Protein-Mechanik experimentell im Labor: Mit Einzelmolekül-
Kraftspektroskopie (SMFS) kann man die beteiligten Kräfte sehr genau
untersuchen, sie ist zwar präzise, jedoch sehr langsam und aufwendig.
Entsprechend wenige Protein-Interaktionen sind deshalb mit dieser
Technik bislang vermessen worden. Eine Datenbank mit Proteinen, die
in den letzten 30 Jahren mittels SMFS charakterisiert wurden, enthält
kaum mehr als 85 Einträge.
Das übergeordnete Ziel von PHENOMECHANICAL (Phenotyping of
protein mechanics Libraries to unravel the design principles of catch
bonds) ist es deswegen, eine umfassende Bibliothek mit Datensätzen zu
Tausenden Protein-Protein-Wechselwirkungen zu erstellen. Dafür will
Milles eine Methode etablieren, die mechanische Kräfte zwischen
Proteinen mit hohem Durchsatz vermessen kann: „Die zentrale
Innovation besteht darin, die Lebensdauer einer Bindung mit einer DNA
-Sequenzierung zu verknüpfen, indem der Phänotyp mit dem
sequenzierbaren Genotyp gekoppelt wird.“ Die Auflösung wird mit
etablierten Ansätzen vergleichbar sein, der Durchsatz jedoch um
mindestens zwei Größenordnungen beschleunigt.
Genau dieser erhöhte Durchsatz wird genutzt, um die
Konstruktionsprinzipien von Catch Bonds mithilfe von De-novo-
Proteindesign zu identifizieren. „Letztendlich ist es mein Ziel,
künstlich designte Catch Bonds mit anpassbarer Lebensdauer zu
entwickeln, die in neuen Biomaterialien oder als synthetische
Zellrezeptoren Anwendung finden könnten“, so Milles. „Die Kombination
von Protein-Design und Hochdurchsatz-Analysen wird große Datensätze
zur Proteinmechanik liefern, die für Machine-Learning-Ansätze
geeignet sind und dadurch möglicherweise Wege eröffnen, das Catch-
Bonding-Verhalten allein aus der Proteinstruktur vorherzusagen.“